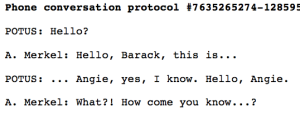Deutschlandweit wird über Google Street View diskutiert, als ob dem Daten-Jäger-und-Sammler-Konzern mit dem Abfotografieren öffentlich einsehbarer Fassaden ein gar ausgefuchstes Schurkenstück gelungen sei, das unsere dunkelsten Geheimnisse erst ans Licht zerrt und dann im bösen Internet wie auch in Echtzeit präsentiert. Der Fachmann empfiehlt hierzu dem Bedenkenträger: Einfach einen pubertierenden Sprayer engagieren, der die Hauswand mit obszönen Graffiti dekoriert, dann muss Google auch ohne Antrag fröhlich drauflospixeln. 
Andernorts im globalen Dorf hat derweil Facebook – in Sachen Sammeln und Auswerten von Web-Nutzungsdaten größter Google-Konkurrent – zunächst für den US-amerikanischen Teil seiner über 500 Mio. Benutzer von jetzt auf gleich den neuen Dienst “Places” freigeschaltet, der die Frage der Privatsphäre tatsächlich neu aufwirft – wieder einmal, muss man sagen, Facebook hat schließlich ein Händchen dafür, sich in Sachen Datenschutz unbeliebt zu machen: “Anträge für Hypotheken sind oft schneller und leichter auszufüllen als Facebooks Datenschutz-Einstellungen”, frotzelte zum Beispiel der britische Guardian.
Mit Places imitiert Facebook die jüngst sehr erfolgreichen Dienste der Geolocation-Community-Anbieter wie Foursquare und Gowalla: Benutzer können damit an Lokationen “einchecken”, sich darüber mit anderen Anwendern austauschen und Kommentare oder Bewertungen zu Kneipen, Restaurants, Geschäften etc. abgeben sowie Abzeichen (Badges) sammeln oder auch Boni einheimsen.
Den Trend hatte Facebook zunächst verschlafen – dabei hätte jeder Immobilienmakler den Facebuchmachern sagen können, was wirklich zählt: “Location, location, location!” Denn mit dem Einbinden von Ortsangaben hat Facebook nun eine Plattform, mit der sich in Echtzeit gezielt ortsabhängige Werbung vermarkten lässt – und das potenziell an eine halbe Milliarde Leute.
Über die Auswertung der Posts und Connections kennt Facebook die Interessen und das soziale Umfeld eines Anwenders; mit Geolokationsdaten – per Smartphone bei Check-ins automatisch generiert – lässt sich zudem nun ein genaues Bewegungs- und damit tatsächlich belegbares Verhaltensprofil erstellen. So etwas ist für Marketing-Profis Gold wert – Places könnte locker Facebooks einträglichster Dienst werden. Entsprechend wurde auch schon spekuliert, dass weniger Communities wie Foursquare und Gowalla, sondern vielmehr Online-Branchendienste wie Yelp unter die Räder des Places-Erfolgszuges geraten dürften – von den eh schon schwächelnden lokalen Print-Medien ganz zu schweigen.
Der “gläserne Konsument” wird damit Wirklichkeit – aber kein Grund zum Jammern, es wird ja keiner gezwungen, oder? Nun, gezwungen nicht, jedoch ging Facebook bei der Einführung von Places einmal mehr recht facebookisch vor: Der Dienst wurde automatisch für alle freigeschaltet – eingegebene Lokationsdaten sind somit sofort für den Freundeskreis (”Friends Only”) sichtbar (immerhin nicht “für alle” – ein Desaster wie das rund um den Start von Google Buzz wollte Facebook-Chef Mark Zuckerberg sich offenbar ersparen). Wer diese Places-Nutzung nicht wünscht, muss das manuell ändern.
Die Pointe kommt aber erst noch: Check-ins können auch andere Facebook-Teilnehmer für einen Anwender vornehmen. Was das für jeglichen Anspruch auf Privatsphäre bedeutet, sollte sofort klar sein: Kannste in die Tonne treten. Unerwünschte Nebenwirkungen treten plastisch vor’s Auge, wenn man sich – am besten nach Lektüre von Max Goldts “Krieg der Mädchenschweigekreise” – einschlägige Teenager-Tweets vorstellt: “Und wenn du mich weiter nervst, dann check ich dich bei Lidl ein!”
Was auf die Places-Einführung folgte, ist ein Ablauf, den wir wohl als Prototypen für Datenschutz im Facebook-Zeitalter betrachten dürfen: Facebook schaltet einen neuen Dienst frei, und einschlägige Websites überschlagen sich sofort im Posten von Anleitungen, wie man ihn wieder abschaltet. Und so schrieb dann auch die Online-Publikation SocialMediaToday ironisch: “Wir alle hassen Facebook Places jetzt schon.”
Deshalb folgt diesmal zur Illustration kein Cartoon oder sonst ein buntes Bildchen, sondern – man will sich ja keinem Trend verweigern – zwei Screenshots, wie man die drei betreffenden Einstellungen vornimmt: Man klickt rechts oben auf den Konto-Button, dann auf Privatsphäre-Einstellungen, dort auf den Link in der Mitte namens “Benutzerdefinierte Einstellungen”), stellt “Orte, die ich besuche” auf “Nur ich” und nimmt dann folgendes Häkchen raus:

Schließlich folgt etwas weiter unten eine dritte Änderung:

Es gibt aber auch eine alternative Strategie zum Schutz der bröckelnden Konsumenten-Privatsphäre: Einfach tagein, tagaus im Vorbeigehen immer nur bei ein und demselben Geschäft einchecken und dann gucken, was für Werbung im Lauf der Zeit so hochpoppt. Das kann, je nach gewählter Lokation, sicher sehr unterhaltsam werden – von meinem Home Office aus zum Beispiel ist die nächste öffentliche Einrichtung ein buddhistischer Tempel…
Wie sang schon die kanadische Comedy-Truppe “Three Dead Trolls in a Baggie” in ihrem höchst unterhaltsamen “Privacy Song“:
“You can lie to the man, you can lie right through your tooth.
They can take away our privacy,
but they can’t have the truth.”
(”Du kannst die Leute anlügen, bis sich die Balken biegen.
Sie können unsere Privatsphäre wegnehmen,
aber die Wahrheit bekommen sie nicht.”)
Im Augenblick ist check-in-mäßig noch Abwarten und Teetrinken angesagt: Places funktioniert derzeit nur in den USA. Aber sicher kommt der Dienst auch bald zum buddhistischen Tempel Ihres Vertrauens!